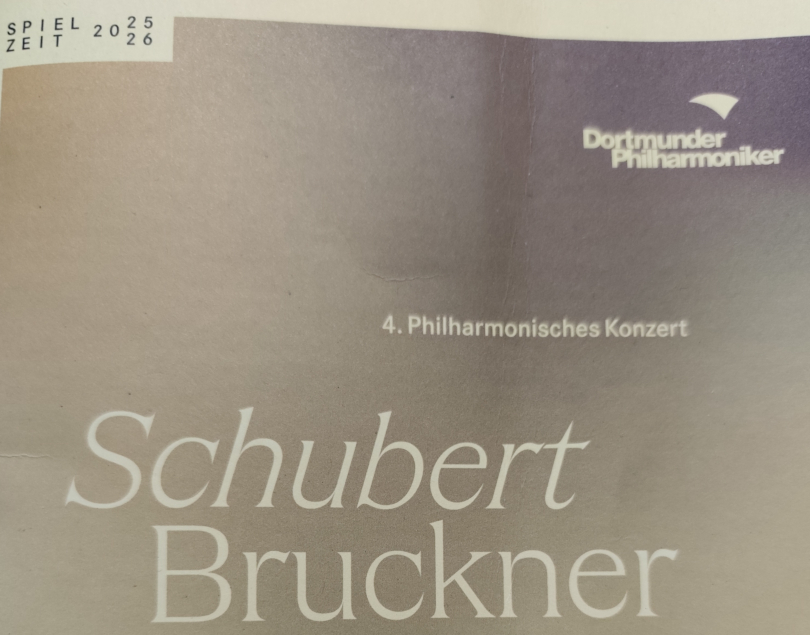Unter Wölfen – Die letzte Premiere im Schauspiel am Hiltropwall
Nach dem Schlussapplaus an diesem besonderen Abend kündigt die Schauspieldirektorin Julia Wissert es an: Die Uraufführung von „PIDOR und der Wolf“ des amerikanischen Autors Sam Max ist tatsächlich die letzte Premiere im alten Gebäude des Schauspiels Dortmund.
Als „wahres Schauermärchen“ bezeichnet der Autor sein dicht gewebtes Familiendrama, in dem es um die Verfolgung queerer Menschen in einem tyrannischen Staat geht. Das Thema ist höchst aktuell, auch mit Blick auf autokratische Tendenzen in westlichen Demokratien. Das Dortmunder Ensemble unter der Regie von Jessica Samantha Starr Weißkirchen gestaltet daraus einen bisweilen anstrengenden, vor allem im ersten Teil manchmal überdramatisierten Theaterabend, was der Inszenierung aber wenig von ihrer Intensität nimmt. Auch wenn es wahrlich keine leichte Kost ist – die Aufführung besticht durch das intensive und körperbetonte Spiel der Darsteller, die fantasiereiche, variable Ausstattung (Wanda Traub) und immer wieder durch eindrucksvolle Bilder.
Beinahe märchenhaft geht es los. Auf der Bühne wabert Nebel, rechts und links stehen dunkle Tannen und mittendrin eine schräge Hütte; wie ein Gewächshaus sieht es aus, erinnert aber auch an das Hexenhäuschen aus „Hänsel und Gretel“. Aber im Haus und drumherum ist es weniger märchenhaft: Eine Frau raucht mit zitternden Händen, ein Kind wuselt herum und ein Mann läuft hin und her wie ein gehetztes Tier, sieht sich nervös immer wieder um und bleibt schließlich vor der Gartenpforte stehen. Dieser Beginn markiert den Ton der Inszenierung, den Rhythmus und die Atmosphäre. Eine dramatische Saite wird angeschlagen und klingt den ganzen Abend nach – nicht beschaulich, eher bedrohlich, schauermärchenhaft.

(Foto: ©Birgit Hupfeld)
Der Mann am Tor ist Peter, der schon als Kind auf dem Spielplatz als „Pidor“, als „Schwuchtel“ beschimpft und gedemütigt wurde. In Tschetschenien, wo Sam Max sein Stück ansiedelt, wird wie in keiner anderen Region brutal gegen LGBTQ+-Personen vorgegangen. Entführungen, Folter, Mord – jedes Mittel ist recht. Peter versteckt sich deshalb als Vater in einer Kleinfamilie, die ihm aber nicht nur als Tarnung dient. Hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu Frau und Kind und seiner Sehnsucht, verabredet er sich ausgerechnet am Vorabend des achten Geburtstages seines Sohnes mit einem Mann, der sich Wolf nennt. Hoch und heilig verspricht er, am nächsten Tag wieder da zu sein, aber dann geht alles schief. Denn dieser Wolf ist ein Agent, der für die autokratische Regierung queere Personen aufspürt; das Date ist eine Falle. Peter landet im Gefängnis, wo er seine Jugendliebe, den Musiker Ilya, wiedertrifft. Erst acht Jahre später sieht er seine Familie wieder.
Dieser Plot ist die Grundlage für ein Drama, in dem Sam Max aufschlüsselt, wie sich die ganze Grausamkeit eines autokratischen Systems in den Körpern und Köpfen seiner Opfer niederschlägt und zu wirken beginnt. Peters Frau ist gezwungen, sich mit den Machthabern zu arrangieren; sie prostituiert sich, heiratet sogar den Wolf – aus Trotz, aus Kalkül oder aus Angst.
Am meisten aber leidet Peters Sohn, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird. Sowohl als Achtjähriger als auch als Jugendlicher mit sechzehn tritt er in Erscheinung. Oft erzählt er von sich in der dritten Person, wie es auch die übrigen Protagonisten immer wieder tun. Diese Erzähltechnik hilft den Figuren, Distanz aufzubauen zu ihren heftigen, widersprüchlichen und manchmal selbstzerstörerischen Gefühlen. Man folgt dieser Erzählung nicht mühelos, aber doch aufmerksam und mit Interesse.
Es ist vor allem dieser narrative Rahmen, der an Sergei Prokofjews Musikmärchen für einen Erzähler und Orchester aus dem Jahre 1936 erinnert, in dem der Protagonist auch den schützenden Garten verlässt und so dem Wolf eine Tür öffnet. Prokofjews Geschichte endet allerdings damit, dass der Wolf in den Zoo gebracht wird; Max’ „Schauermärchen“ dagegen mündet in einem grausamen Showdown, wo sich alle am sechzehnten Geburtstag von Peters Sohn wiedertreffen – ein ungeschöntes, hoffnungsloses Ende, eine Botschaft, die aufrüttelt.
Natürlich lebt die Inszenierung auch von der Musik Chiara Stricklands und dem live aufspielenden Cellisten, besonders aber von den souverän agierenden Schauspielern, die hin und wieder den dramatischen Ton ein wenig überstrapazieren, die sich aber ansonsten voll in jede Situation reinhauen mit Leib und Seele. Der Chor der Wölfe ist großartig choreografiert und in Szene gesetzt; diese pöbelnden, feixenden, brutalen Handlanger des Regimes erinnern an die uniformierten ICE-Agenten in Amerika. Die Aktualität der Inszenierung wird dadurch noch unterstrichen. Ein außerordentlicher Abend: anstrengend, aber unbedingt sehenswert.